
Anzeigen
Brennpunkt Nahost
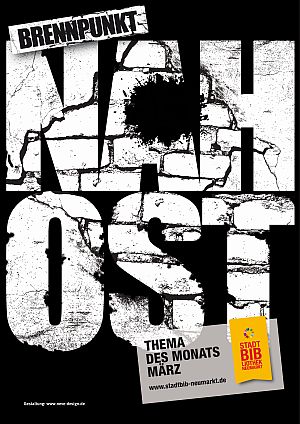
- In „Endstation Islamischer Staat“ beschreibt Rainer Hermann, wie der IS das Machtvakuum in Syrien und dem Irak mit einem „Staatsersatz“ ausfüllte. Anschaulich vergleicht der Islamwissenschaftler die Situation mit der in Europa im 17. Jahrhundert. Hier verwüstete der 30jährige Krieg ebenfalls ganze Landstriche, und Frieden gab es erst, als sich die Einsicht durch setzte, Staat und Religion zu trennen. Mit dem Titel „Allahs Narren“ brandmarkt Boualem Sansal die Beschränktheit der fanatischen IS-Ideologen und zeigt die Gründe sowohl für das Erstarken des Islamismus als auch die Mitverantwortung des Westens auf: die Unterstützung autoritärer Militärregime und das Schweigen sowohl arabischer als auch westlicher Intellektueller.
- „Der Name meines Bruders“ von Larry Tremblay macht am Beispiel der neunjährigen Zwillinge Amed und Aziz deutlich, wie der Krieg sich bis in einzelne Familien hinein auswirkt. Als eine Bombe auf ihr Dorf im Nahen Osten fällt, kommen einflussreiche Männer und predigen Rache. Einer der Jungs soll mit einem Selbstmordattentat zum Märtyrer werden, und weil Aziz unheilbar krank ist, fällt die Wahl auf Amed. Nur durch eine List gelingt es der verzweifelten Mutter, nicht beide Söhne zu verlieren. In Kanada inzwischen Schullektüre! Unter die Haut geht auch „Sommer unter schwarzen Flügeln“ von Peer Martin. Nuri kommt aus Syrien. Sie will sich an dem Rechtsradikalen Calvin rächen, der ihren Bruder zusammengeschlagen hat. Doch als Calvin eines Tages durch einen maroden Balkon zu brechen droht, rettet Nuri ihm das Leben. Damit kommt Calvins rechtsradikale Überzeugung ins Wanken.
- Spannend und aufrüttelnd ist „Aliyahs Flucht oder Die gefährliche Reise in ein neues Leben“ von Güner Yasemin Balci. Die Geschichte eines kurdischen Mädchens, das einen Griechen liebt, gibt Einblicke in die allen Veränderungen trotzende Innenwelt muslimischer Familienstrukturen und abgeschotteter Nachbarschaften, in denen viele Teenager in Deutschland aufwachsen. Kritisch werden Missstände hinterfragt wie die Rolle selbstgefälliger Migrantenvereine, die behördlichen Verfahrensweisen und unser weit verbreitetes Wegducken vor einer anderen Kultur. Als Ergebnis verweist die Autorin auf Ehrenmorde und die hohe Selbstmordrate.
- Spannend wie ein Roman liest sich „Afghanistan. München. Ich“ von Hassan Ali Djan. Der Autor landete nach einer lebensgefährlichen Flucht mit 16 Jahren in Deutschland – allein, als Analphabet und ohne jede Schulbildung. Sein Ziel: lernen und Geld verdienen, um so seiner Familie daheim ein besseres Leben zu ermöglichen. Mit bewundernswerter Willensstärke überwindet er alle Widerstände und ist heute voll integriert in der deutschen Gesellschaft.
- In „Abaya“ schildert Kerstin Wenzel schonungslos ihr eigenes Schicksal. Ihr syrischer Mann erwies sich als gewalttätig. Noch kinderlos, reichte sie die Scheidung ein, gab ihm aber eine „zweite Chance“. Als Ergebnis bekam sie vier Kinder, während er sich in die Salafistenszene verstrickte. Ein Urlaub in den Arabischen Emiraten wird zur Falle für sie und die Kinder. Fortan leben sie im „Gefängnis mit Meerblick“ – bis die Flucht gelingt.
- In „Frauenpower auf Arabisch: Jenseits von Klischee und Kopftuchdebatte“ lässt Karim El-Gawhary arabische Frauen zu Wort kommen: Umm Naama, die mit einem Euro am Tag ihre sechsköpfige Familie durchbringt; Mariam, die gegen die sexuelle Gewalt am Kairoer Tahir-Platz kämpft; Sareen, die ehemalige Scharfschützin Gaddafis; die junge Widerstandskämpferin Kouki; die Palästinenserin Kamile, deren Sohn in den „heiligen Krieg“ zieht; Umm Kaled, die einzige LKW-Fahrerin Ägyptens, die mit ihrem 30-Tonner durch das Nilland brettert; und schließlich Manal, die sich als erste saudische Frau beim Autofahren filmen ließ.
- „Der Himmel ist ein Taschenspieler“ von Tanja Langer ist eine afghanische Familiengeschichte, die west-östliche Lebens- und Überlebensformen vor Augen führt. Im Mittelpunkt steht der neunjährige Mahboob, der mit seiner Mutter nach Deutschland fliehen muss. Als er 20 Jahre später zu seinem Vater nach Kabul zurückkehrt, sieht er sich widersprüchlichen Gefühlen von Vertrautheit und Fremdheit, von Angst und Freude ausgesetzt. Hinter dem Titel „Afghanistans verborgene Töchter“ steckt eine Zufallsentdeckung der schwedischen Journalistin Jenny Nordberg: viele Mädchen in Afghanistan werden demnach bis zur Pubertät als Jungen verkleidet und dürfen ein freieres Leben führen, etwa draußen spielen oder die Schule besuchen. Denn Eltern ohne Söhne gelten als Versager, und in vaterlosen Familien müssen verkleidete Mädchen als Kinderarbeiter die Familie ernähren.
- Unter dem Titel „Am Abgrund“ legt der pakistanische Journalist Ahmed Rashid die aktuell vielleicht beste politische Analyse über die Krise in Pakistan/Afghanistan und den fortschreitenden Niedergang der ganzen Region vor. Bezeichnend für die Problematik des militärischen Rückzugs das Zitat eines westlichen Botschafters: „Wird es eine afghanische Armee und eine zivile Verwaltung geben, die übernehmen kann, oder knipsen wir einfach das Licht aus?“ „Plötzlich Pakistan“ heißt Hasnain Kazims spannende Reportage. Politik, Militär, Alltagsleben, Religion, Kultur und Natur – das ganze Spektrum beleuchtet kenntnisreich der Sohn pakistanischer Einwanderer, der als Auslandskorrespondent in der Heimat seiner Eltern tätig war.
13.03.16
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
